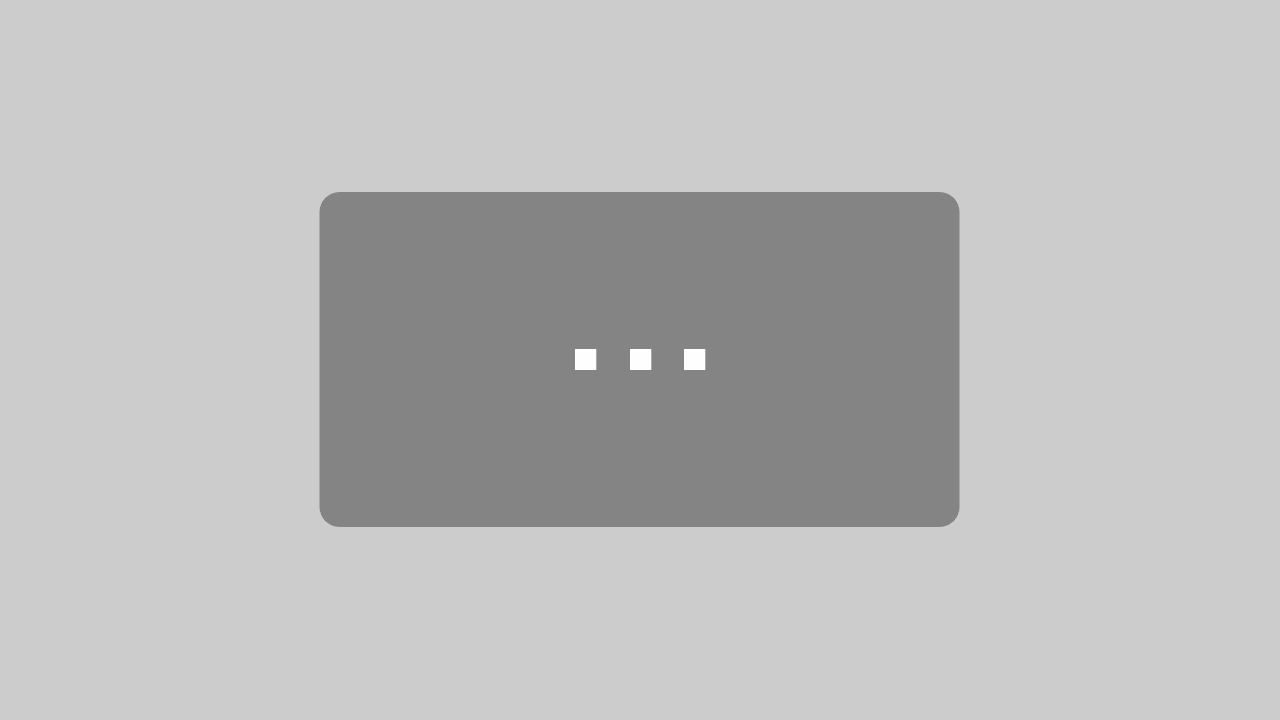Die neue Ruhe nach dem Song wirkt gewöhnungsbedürftig. Doch der Rückzug der Kultur ins Internet birgt auch einen gewissen Charme. Wir werden uns daran gewöhnen und Wege der Monetarisierung finden müssen.
Wenn du für den Applaus lebst, für das Lächeln in den Gesichtern eines dankbaren, glücklichen Publikums, dann muss sich diese Zeit der abgesagten Veranstaltungen anfühlen wie ein langer, langer Marsch durch die Wüste – ohne auch nur einen Tropfen zu trinken. Künstler, heißt es, brauchen die Bühne, damit sie nicht verdursten. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Denn auch wir, die noch vor kurzem leidenschaftlich den Applaus spendeten, die von Endorphinen angepeitscht den Lieblingssong mitgröhlten oder sich verstohlen eine Träne von der Wange wischten, bevor im Auditorium wieder das Licht angeht – auch wir dürsten ja nach „unseren“ Künstlern; nach den Musikern, den Schauspielern, den Kabarettisten, nach ihrem Zauber, nach diesem unvergleichlichen Gefühl, gemeinsam mit hunderten oder tausenden Gleichgesinnten etwas Ergreifendes, Witziges, Trauriges oder Tröstendes erleben zu dürfen. Diese Kraft, Herz und Verstand so tief zu berühren, haben nur zwei Dinge: die Liebe und die Kunst; und der Mensch, das haben die letzten Wochen bewiesen, kann weder ohne das eine, noch ohne das andere gut leben. Im Idealfall geht das ja ohnehin Hand in Hand. Wir sagen nicht von ungefähr, dass wir die Musik von dieser oder jener Band lieben. Da standen beide Parteien – Publikum und Künstler – angesichts des Kontaktverbots vor einer ganz schönen Herausforderung. Viele Kulturschaffende haben sie gemeistert, indem sie neue Wege fanden, um auch ohne die klassische Bühne mit uns Fans in Kontakt zu bleiben. Sie eroberten den digitalen Raum als Experimentierfeld, Spielwiese und neuen Schauplatz des künstlerischen Geschehens.
Holzparkett, an der Wand ein schwarz-weißes Gemälde, weiße Gardinen, ein Beistelltischchen voller Bücher – und natürlich der schwarze Steinway. In den letzten Wochen hatte ich dieses Wohnzimmer oft vor Augen. Es gehört dem deutsch-russischen Pianisten Igor Levit, liegt irgendwo in Berlin und wurde während der Hochphase dieser „Corona-Krise“ nicht nur für mich zu einer Art Heimstatt der Hoffnung. Levit, zweifelsohne einer der größten seiner Zunft, lud die ganze Welt 52 Abende hintereinander zu sich nach Hause ein, wo er uns seinen Wohnzimmerkonzerten lauschen ließ, die er live und gratis ins Netz stellte. Ganz ohne viel Brimborium oder technischen Schnickschnack. Er klemmte einfach jeden Abend um kurz vor 19 Uhr das Handy auf ein Stativ, setzte sich ans Klavier und legte los. Über Twitter und Instagram streamte er, wie er Bach, Beethoven, Hendrix, Mozart, Schumann oder Schostakowitsch spielte. Ohne Notenblätter, manchmal strumpfsockig, manchmal in braunen Lederslippern, immer im bequemen Schlabberpulli, ganz so, als übte er nur, für sich allein – dabei sahen im Schnitt 20.000 Menschen zu. Ein Geschenk des Himmels! Ob ich ohne diesen Stream jemals in den Genuss eines seiner Konzerte gekommen wäre?

Künstler präsentieren ihre Musik im Stream
Ortswechsel beim Blick durch das Display. Das Handy, ich geb’s unumwunden zu, war in den vergangenen Wochen mein treuester Begleiter, mein Fenster zur Welt. Ein Fenster, das plötzlich Einblicke gewährte, die wir vorher nicht zu Gesicht bekamen. Szenen wie in dieser Airbnb-Bude zum Beispiel, irgendwo in Australien. Dort war der Sänger und Entertainer Robbie Williams wochenlang in Quarantäne gehockt und hatte ebenfalls allabendlich den Stream angeschmissen. Vorzugsweise turnte er im gelben Pulli mit Mickey-Mouse-Druck vor der Kamera herum, meist unrasiert, mal mit müden Augen, mal putzmunter, ein Mensch wie du und ich, der vor sich auf dem Tisch einen Haufen bunter Stifte hortete, mit denen er Mandalas malte, während er auf „Zuruf“ wilde Karaoke-Versionen eigener und Songs anderer Musiker schmetterte. Ein absurdes Theater von Beckettscher Güte. Herrlich unperfekt, so ohne die gewohnte Choreografie oder Setlist, einfach spontan und ungefiltert. Dermaßen nahbar wirken die Stars sonst selten, selbst wenn sie nur fünf Meter entfernt auf der Bühne stehen. Auf einmal sitzen wir im selben Boot, auf Augenhöhe – und die scheint beiden Seiten bei aller Tragik auch Spaß zu machen.
An diese neue Nähe wagten sie sich natürlich auch hierzulande, im Örtchen Riedering im Landkreis Rosenheim zum Beispiel. Hier betreibt der Musiker, Toningenieur und Produzent Stephan Zeh im Keller unter seinem Privathaus die „Mischbatterie“, ein renommiertes Tonstudio, das zwar auf dem Lande liegt, aber musikalisch zu den ersten Adressen gehört. Wo schon Plácido Domingo Arien einsang, entstand zuletzt auch „Alles auf Hoffnung“, das aktuelle Album des Münchner Sängers Gil Ofarim. Ende Februar veröffentlicht, ist die Scheibe auf Platz 5 in die Deutschen Albumcharts eingestiegen – um jäh ausgebremst zu werden. Der Sänger erzählt, dass er so einen Erfolg in Deutschland seit 20 Jahren nicht hatte. Doch reiten auf dieser Erfolgswelle habe er nur zwei Wochen können. Dann rollte eine Welle namens Corona heran und riss ihn buchstäblich vom Brett. Zweieinhalb Jahre habe er an dem Album gearbeitet, sagt Ofarim, sechs Monate davon eingebunkert im Studio von Stephan Zeh. „Aber als Künstler möchte ich raus, auf die Bühne, möchte ich spielen!“ Also machten auch Gil Ofarim und Stephan Zeh aus der Not eine Tugend. Sie begannen, kleine, intime Studio-Sessions zu streamen. Immer freitags, mit Unterstützung der bekannten Pop- und Soulsängerin Cassandra Steen, die auch an zwei Songs des Albums mitgewirkt hat. Die Resonanz darf man durchaus als überwältigend bezeichnen. 80.000 Menschen guckten bei der Premiere zu. Und wiederum gilt aus Sicht des Zuschauers: Das ist mehr als ein Ersatz. Es ist ein anderes, aber es ist kein schlechtes Konzerterlebnis, obwohl man lediglich mit dem Handy in der Hand auf der heimischen Couch liegt, obwohl der Applaus nur optisch aufbrandet, in Form von tausenden Herzen am Bildschirmrand und in Form von überschwänglichen, dankbaren Kommentaren.
So viel zur Seite der Fans – aber wie fühlte und fühlt es sich für die Künstler an, im sogenannten stillen Kämmerlein zu performen? „Die ersten beiden Shows waren total seltsam“, sagt Stephan Zeh, „so ganz ohne Feedback.“ Irgendwann habe es aber Klick gemacht und mittlerweile sei das virtuelle Musizieren überhaupt kein Problem mehr. Gil Ofarim sagt, er spüre einen „besonderen Austausch mit den Fans“ und einen völlig neuen Flow. Es fühle sich natürlich völlig anders an als auf der Bühne – ohne diese Vibes, ohne die Zwischenrufe, auf die man eingehen kann – trotzdem sei etwas da. „Man liest zwar nur die Kommentare, aber das gibt einem trotzdem sehr viel und es gibt vor allem den Menschen da draußen sehr viel“, weiß der 38-Jährige.
Nun wissen wir aber alle auch, dass man von Herzchen und Gunst allein nicht leben kann; für den Applaus sehr wohl – von ihm natürlich nicht. Einer, der sofort ahnte, dass auf das Ökosystem „Kultur“ existenzbedrohende Zeiten zukämen, ist Fabian Rauecker. Ökosystem, weil hinter den Menschen, die auf der Bühne stehen, ein ganzer Tross an Helfern hängt: Ohne Aufführungen sterben die Locations, haben die Techniker und Tourmanager nichts zu tun, verdienen Merchandiser, Ticket-anbieter, Grafiker oder Gastronomen kein Geld – von den Künstlern selbst ganz zu schweigen. Rauecker, der normalerweise mit seinem Partner Stefan Schröder die Münchner Konzertagentur „Unterhaltungsreederei“ leitet, ahnte wohl, dass von Seiten der Politik nicht viel zu erwarten war. Er ergriff und gründete die Initiative „#kulturretter“, einen Fond, der von uns Fans gespeist wird und den genannten Akteuren des Kulturlebens direkt und unkompliziert helfen soll. Die Plattform streamt seit Wochen Konzerte, Lesungen, DJ-Sets oder Theaterstücke. Zuschauen kann man gratis, via YouTube, doch wer will, spendet oder kauft sogenannte Unterstützer-Items. Über 100.000 Euro sind dabei bislang zusammengekommen – und wenn man sich vergegenwärtigt, als welche Luftnummer sich das staatliche Unterstützungsprogramm inzwischen entpuppt hat, sind die auch bitter nötig.

Wer ist es wert, gerettet zu werden in unserer Gesellschaft – soll heißen: angemessen unterstützt? Im Rahmen dieser Diskussion taucht immer wieder ein Wort auf: das der Systemrelevanz. Schon kurios, dass das Land der Dichter und Denker sich diese Frage für sein Kulturleben stellt. Rauecker beantwortet sie ganz ohne Umschweife: „Ohne Kultur wäre unser Alltag ziemlich scheiße!“ Und da hat er verdammt nochmal Recht! Womit verbringen Sie, liebe LeserInnen, denn Ihre Zeit, wenn Sie sozusagen ausgestempelt haben? Eine Umfrage hat mal ergeben, dass wir allein zwölf Jahre unseres Lebens fernsehend verbringen, weitere zwölf Monate im Kino, im Theater oder auf Konzerten. Da dürfen wir uns ganz schön was einfallen lassen, wenn wir die Schauspieler, Musiker, Regisseure und all die anderen Kulturschaffenden nun ausbluten lassen.
Die neue Kultur der Streams hält Rauecker jedenfalls für keinen adäquaten Ausgleich. Weniger aus finanziellen, denn aus emotionalen Gründen. „Kultur“, sagt der erfahrene Veranstalter, „bringt Menschen seit jeher zusammen.“ Auf einem Konzert oder einem Festival sei es egal, woher man kommt oder wieviel Geld man verdient – in diesem Moment seien alle gleich. Rauecker glaubt, dass zwar die persönliche Kommunikation zwischen Künstlern und Fans dank der sozialen Medien in Zukunft direkter und wichtiger werden wird, doch er vertritt auch die Auffassung, dass ein Konzert von der Verbindung zwischen den Künstlern auf und dem Publikum vor der Bühne lebt. Da entstehen Erinnerungen für das ganze Leben. Rauecker denkt immer wieder gern an diesen Moment zurück, als Dave Grohl, Frontmann der amerikanischen Rockband Foo Fighters, bei einem Konzert in Göteborg von der Bühne plumpste, um nach kurzer Behandlungspause mit gebrochenem Hax weiterzuspielen. „Im Idealfall“, hofft der Kulturretter, „schafft die aktuelle Situation wieder ein Bewusstsein dafür, wie wichtig Kultur für uns alle ist, und dass alles unternommen werden sollte, um diese Vielfalt zu erhalten.“
Bislang ist von offizieller Seite wenig davon zu spüren, wenn man Kunstschaffende fragt. Gil Ofarim zögert nur kurz, ehe er zugibt, sich allein gelassen zu fühlen von den Entscheidungsträgern. „Von all den Menschen da draußen werden wir sehr wahrscheinlich die letzten sein, für die es irgendwann wieder weiter geht – wenn es überhaupt weiter geht, wie es mal war.“ Vielleicht müssen wir uns wieder einmal umstellen; wie damals, als die CDs den Streamingplattformen wichen; und uns an Online-Tickets für Online-Konzerte, Online-Lesungen und Online-Theateraufführungen gewöhnen. Wir wollen doch alle nicht, dass die Kunst verstummt? Vorerst vertraut einer wie Gil Ofarim noch auf die prophetische Kraft seiner Platte. Er setzt „Alles auf Hoffnung.“ Die Alternative wäre aufgeben. „Aber aufgeben“, betont er, „aufgeben ist nicht meins!“